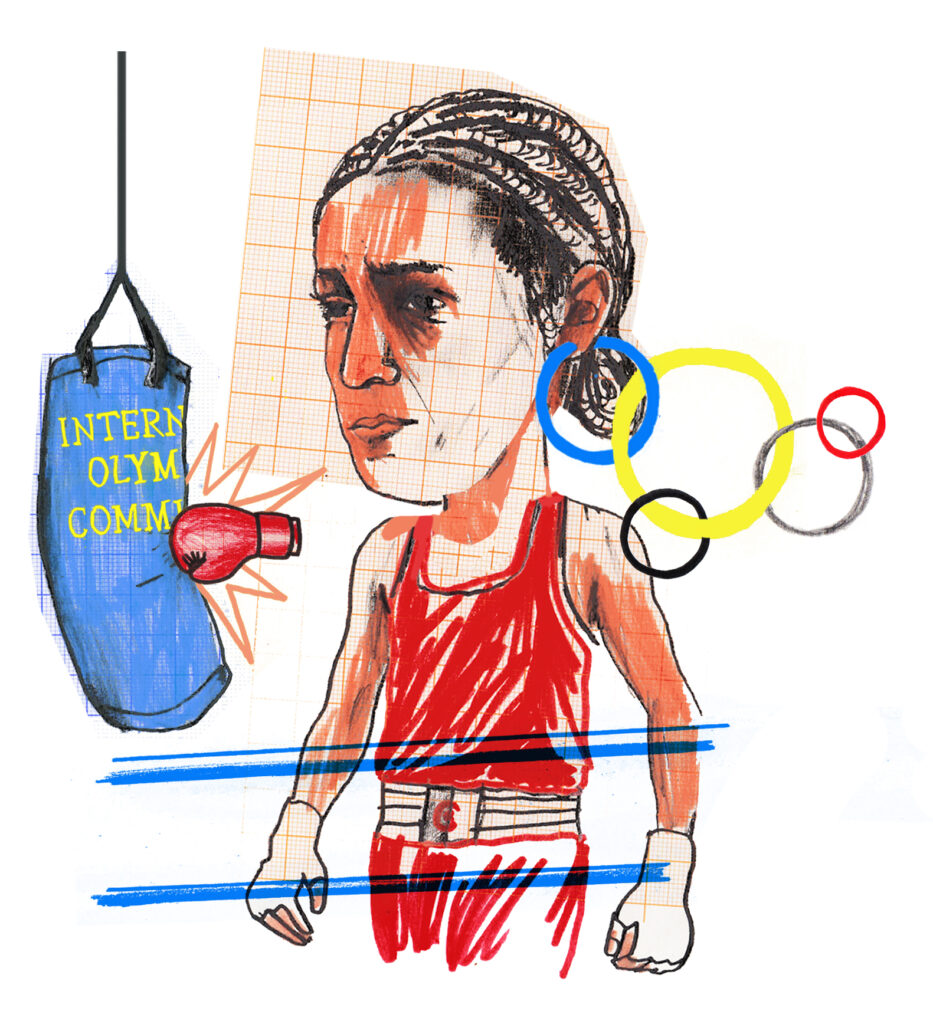Warum bleiben auch gut gebildete Frauen zu Hause oder begeben sich freiwillig in die sogenannte Teilzeitfalle? Die SPD sagt, weil das Steuerrecht sie dazu ermuntert. Aber was, wenn Frauen einfach cleverer sind als Männer?
Die SPD will gegen überholte Rollenbilder vorgehen, so hat es die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, angekündigt. Als überholt gilt der SPD eine Familie, in der ein Elternteil zu Hause bleibt, um sich um Haushalt und Kinder zu kümmern. Nur die Familie, in der beide Ehepartner voll arbeiten, lebt auf der Höhe der Zeit und damit konform mit den Werten der Sozialdemokratie, so muss man Frau Esdar verstehen.
Woran es liegt, dass die Ehe bei vielen Deutschen in der Vormoderne stecken geblieben ist? Auch darauf hat die SPD eine Antwort. Ihre Experten sagen, dass das Ehegattensplitting an der misslichen Lage schuld sei, weil es alte Rollenbilder zementiere. Wegen des Steuervorteils lohne es für Frauen oft nicht, mehr zu arbeiten. Weg mit dem Ehegattensplitting, lautet deshalb die Forderung der Stunde.
Um allen Verdächtigungen gleich die Spitze zu nehmen: Was die Zementierung überholter Rollenbilder angeht, habe ich mir ausnahmsweise nichts vorzuwerfen. Bei der häuslichen Verteilung der sogenannten Care-Arbeit bin ich klar in Führung.
Ich bin der Erste, der aufsteht, um das Frühstück für die Kinder zu machen. Ich setze sie in den Bus und hole sie von der Schule ab. Selbstverständlich liegen auch Arzttermine und die Fahrten zum Nachmittagssport in meiner Verantwortung. Meine Frau hasst es, wenn ich auf dem Thema herumreite. Sie sitzt, anders als ich, die meiste Zeit des Tages im Büro. An dieser Stelle muss ich allerdings aus Selbstschutz sagen, wie es ist.
Aber wer weiß, vielleicht sind sie bei der SPD längst weiter. Was heute noch à jour war, kann morgen schon überholt sein. Ich habe deshalb in Erfahrung zu bringen versucht, was man vom SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil als Rollenvorbild lernen kann. Es ist gar nicht so einfach zu sagen. Er macht ein großes Geheimnis um sein Privatleben. Im vergangenen Jahr ist er Vater geworden, das immerhin lässt sich in Erfahrung bringen.
Ich mag komplett falschliegen, aber wenn ich mir die Termine des SPD-Chefs anschaue, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Mann zu Hause seinen gerechten Anteil an der Care-Arbeit leistet. Ich wäre der Letzte, ihm das zum Vorwurf zu machen. Was die persönliche Lebensgestaltung angeht, bin ich ultraliberal. Aber sollte man nicht etwas bescheidener auftreten, wenn man so deutlich die Latte reißt? Just asking.
Lassen wir für einen Moment die Frage beiseite, ob die Regierung nicht schon genug damit zu tun hat, gegen den wirtschaftlichen Niedergang zu kämpfen. Das beste Rollenbild taugt nichts, wenn es niemanden mehr gibt, der die Familie ernähren kann. Dann müssen beide zu Hause bleiben, das ist dann doppelt veraltet. Oder kommt es nur darauf an, dass nicht einer mehr arbeitet als der andere? Dann würde auch die geteilte Arbeitslosigkeit als vorbildlich gelten, weil in dem Fall alle daheim sind. Man müsste mal Frau Esdar dazu befragen.
Die „Spiegel“-Redakteurin Laura Backes hat vor ein paar Wochen ausführlich mit Tradwives gesprochen, eine Wortschöpfung aus „traditionell“ und „Ehefrau“. Es handelt sich dabei um einen Trend aus den Vereinigten Staaten, der jetzt auch nach Deutschland schwappt. Genau genommen ist es eine uralte Sache: Die Frau kümmert sich um den Haushalt, der Mann schafft das Geld ran. Weil aber die Tradwives ihr Leben auf Instagram ausstellen, gilt die Sache als hip.
Was mich bei der Lektüre überrascht hat: wie unentschieden die Autorin war. Ich hatte einen Verriss erwartet, eine harte Philippika gegen die Verräterinnen, die alles mit Füßen treten, wofür die Frauenbewegung auf die Straße gegangen ist. Aber nichts da. Zwischen den Zeilen schimmerte ein merkwürdiges Verständnis für die Rückkehr zum traditionellen Lebensstil durch. Man konnte geradezu eine Sehnsucht herauslesen, mal auszusteigen und den ganzen Büroalltag einfach hinter sich zu lassen.
Warum bleiben auch gut gebildete Frauen zu Hause oder begeben sich freiwillig in die Teilzeitfalle, wie das andere Lebensmodell heißt, das die SPD ablehnt? An mangelnden Bildungsabschlüssen kann es nicht liegen. Wir können eine Feminisierung ganzer Berufszweige beobachten. Die Mehrzahl der Mediziner, die die Uni verlassen, sind heute Frauen, auch die Mehrheit der Juraabgänger ist weiblich. Da sie in der Regel außerdem über die besseren Abschlüsse verfügen als ihre männlichen Mitbewerber, stehen ihnen alle Türen offen.
Ich glaube, viele Frauen treten beruflich kürzer, weil sie es wollen. Ich habe mich neulich mit einem Chefarzt einer Klinik in Essen unterhalten. Der Mann suchte händeringend nach Bewerberinnen für zwei offene Oberarztstellen. Aber niemand will den Job machen. Die meisten, die er anspricht, arbeiten gerne als Ärztin, wie sie sagen, aber eben nicht 40 oder 50 Stunden. Und die Verantwortung für eine Station, die wollen sie erst recht nicht.
Die Sache hat eine gesellschaftliche Dimension, nur ganz anders, als die SPD sich das vorstellt. Wenn ein Gutteil der Ärzte beschließt, nur noch 50 Prozent zu arbeiten, hat das unmittelbare Konsequenzen für die Gesundheitsversorgung. Wäre ich bei der SPD, würde ich darüber mal nachdenken, schon unter dem Gerechtigkeitsgesichtspunkt. Das Medizinstudium ist ein relativ teures Studium, vom Steuerzahler mit überschlägig 200 000 Euro pro Studienplatz finanziert. Da muss die Frage erlaubt sein, was er dafür zurückbekommt.
Warum verspüren eher Frauen als Männer den Drang, es ruhiger angehen zu lassen? Möglicherweise sind Frauen
einfach schlauer. Ein Blick auf die Lebenserwartung zeigt, dass ihre Entscheidung der Gesundheit jedenfalls nicht abträglich ist. Fast fünf Jahre
mehr Lebenszeit als Männer – das ist ein halbes Jahrzehnt.
Der Soziologe Martin Schröder hat vor zwei Jahren unter dem Titel „Wann sind Frauen wirklich zufrieden?“ die Ergebnisse der Forschung vorgestellt. Entgegen der weitverbreiteten Annahme, dass viele Frauen sich ungerecht behandelt fühlen, zeigen die Befunde das Gegenteil. Was die Lebenszufriedenheit angeht, lagen Männer zuletzt bei 7,43 von 10 möglichen Punkten, Frauen bei 7,48.
Auch mit dem viel beschriebenen Pay-Gap hadern Frauen weniger, als man vermuten sollte. Ausweislich der Umfragen sahen Frauen beruflichen Erfolg als weniger wichtiger an, was den Gehaltsunterschied erklärt. Wer sich mehr reinhängt, verdient in der Regel auch mehr.
Ich glaube, der Effekt von Steueranreizen wird grundsätzlich überschätzt. Wo Steueranreize funktionieren, sind Abschreibungen. Die Bauherrenmodelle, die Leute eingingen, weil irgendein Steuerberater ihnen das aufgeschwatzt hatte, sind Legion. Aber dass Leute ihre Familienplanung danach ausrichten, ob der Staat einem steuerliche Vorteile gewährt? Da habe ich doch Zweifel.
Wir können ja den Versuch machen. Wir streichen probeweise alle Vergünstigungen und schauen, was passiert. Ich gehe jede Wette ein, dass kaum jemand deshalb darüber nachdenkt, sich an die Werkbank zu stellen, weil die Steuerklasse 5 entfällt. Auf so eine Idee können nur Politiker kommen, die alles für käuflich halten.

© Silke Werzinger