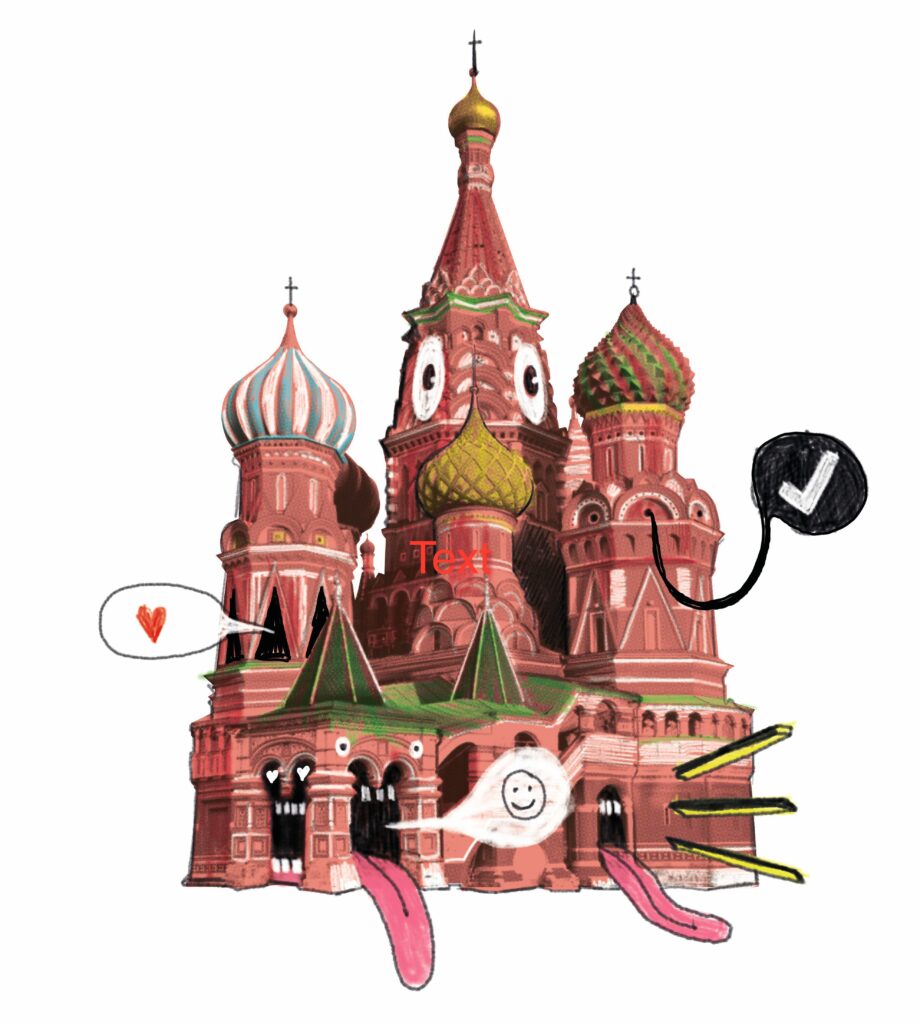Deutschland brauche Einwanderung, um seine Sozialsysteme zu stabilisieren, heißt es. Das ist richtig, ohne Zuwanderer wird es nicht gehen. Aber wie kommt es dann, dass 45 Prozent der Hartz-IV-Empfänger keinen deutschen Pass besitzen?
Lassen Sie mich mit einer Zahl beginnen. Fast die Hälfte der Flüchtlinge, die 2015 zu uns kamen, lebt von Hartz IV oder wie es jetzt vornehm heißt: von Bürgergeld. Also der Zuwendung von Menschen, die arbeiten, damit andere nicht arbeiten müssen.
50 Prozent ist eine erstaunlich hohe Zahl. Es sind acht Jahre vergangen, seit sich der große Flüchtlingstreck aus Syrien in Marsch setzte und dann in Deutschland wieder zum Halten kam. Acht Jahre, in denen man Sprach- und Integrationskurse hätte belegen können oder mutmaßlich sogar belegt hat. In denen man eine Familie gründen, Kinder großziehen und Anschluss an die deutsche Gesellschaft finden konnte.
50 Prozent ist auch eine brutale Zahl. Wer nach acht Jahren noch keine Arbeit gefunden hat, bei dem besteht wenig Hoffnung, dass er sie im Jahre neun oder zehn finden wird. Sehr viel mehr spricht für die Aussicht, dass er sich, selbst wenn er im Besitz zweier gesunder Hände und eines breiten Kreuzes sein sollte, weiterhin auf die Hilfsbereitschaft anderer verlässt.
Deutschland diskutiert mal wieder über die Ausländerpolitik. Es ist dieses Mal eine stille Debatte, sie findet abseits der großen Medien statt. Wenn sich die Kommunalpolitiker mit dem Kanzler zum Flüchtlingsgipfel treffen, erreicht sie die ersten Seiten der Zeitungen. Dann wird sie wieder von anderen Themen verdrängt.
Dabei handelt es sich bei den Sozialleistungen, die der deutsche Staat gewährt, um keine Kleinigkeit. 46 Milliarden haben wir im vergangenen Jahre für die sogenannte Grundsicherung ausgegeben, das ist fast so viel wie für die Landesverteidigung. Mit der Umstellung auf das Bürgergeld kommen noch einmal fünf Milliarden hinzu, so steht es im Haushaltsentwurf. Schon der Begriff Bürgergeld ist allerdings irreführend. 45 Prozent der Bürgergeldempfänger besitzen gar keinen deutschen Pass. Man kann natürlich jeden als Bürger bezeichnen, der sich in Deutschland aufhält, aber damit bewegt man sich zumindest außerhalb des Grundgesetzes.
Was läuft da schief? Es ist ja richtig, dass wir Leute brauchen, die mit anpacken. Überall werden händeringend Arbeitskräfte gesucht. Das ist auch das Argument, das sofort fällt, wenn es um die Migration geht: Deutschland sei auf Einwanderung dringend angewiesen. Aber offenbar gelingt es uns nicht oder nur sehr schlecht, die Menschen, die nach Deutschland kommen, dann auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Am Wochenende hat Justizminister Marco Buschmann das neue Einbürgerungsgesetz, das den Erwerb eines deutschen Passes einfacher machen soll, so kommentiert: „Wir machen die Einbürgerung für Menschen leichter, die von ihrer eigenen Hände Arbeit leben. Die Regeln für Menschen, die vom Sozialstaat leben, werden verschärft.“ Das sei Nazi-Sprache, hieß es darauf. Von „Parasiten-Semantik“ sprach das linke Gewissen der „FAZ“, der Kölner Salonradikale Patrick Bahners. Jede Einwanderung in den Arbeitsmarkt sei automatisch eine Einwanderung in den Sozialstaat, da Deutschland per Grundgesetz ein sozialer Bundesstaat sei.
Man kann sich immer dumm stellen. Oder alle für dumm verkaufen, denen man eben noch erklärt hat, wie wichtig Einwanderung für die Stabilisierung der Rente sei. Wie wohl die Reaktion ausfiele, wenn der Bundeskanzler den Leuten erklären würde, dass selbstverständlich auch jeder als Zuwanderer willkommen sei, der beschlossen habe, dass ihm das Bürgergeld zum Leben reicht? In den Talkrunden, in denen ich sitze, ist davon jedenfalls nie die Rede.
Ich habe vier Jahre in den USA gelebt. In Amerika kommen jede Woche Tausende über die Grenze, daran kann kein Zaun etwas ändern. Dennoch hat die Diskussion über die Einwanderung nie die Hitzigkeit wie bei uns erreicht. Ein Grund ist, dass die USA zwar relativ lax sind, was den Schutz ihrer Grenze angeht, aber ebenso lax, was staatliche Hilfen angeht. Es gibt sie praktisch nicht. Der Mexikaner, der sich ins Land schleicht, muss sehen, wie er zurechtkommt. Da die meisten Menschen findig sind, wenn ihnen nichts anderes bleibt, als sich anzupassen, gibt es auch relativ wenig Integrationsprobleme.
Wir müssen das System von den Füßen auf den Kopf stellen. Ich wäre dafür, die Sozialleistungen für Zuwanderer radikal zu kürzen. Jeder, der sich legal in Deutschland aufhält, bekommt sofort eine Arbeitsgenehmigung. Im Gegenzug entfallen alle Subsidien, es sei denn, jemand ist zu krank oder zu alt, um auf eigenen Beinen zu stehen. Das kann man harsch finden. Aber es ist deutlich weniger harsch, als Flüchtlinge aus Angst vor den Kosten in Lager zu pferchen, damit sie Deutschland nie erreichen.
Wir haben zum Teil aberwitzige Hürden errichtet, um Asylbewerber von geregelter Arbeit fernzuhalten, auch das gehört zur Wahrheit. In den Ausländerbehörden klammern sie sich an die Fiktion, dass die Flüchtlinge selbstverständlich wieder in ihre Heimat zurückkehren werden, sobald der Fluchtgrund entfallen ist. Deshalb wird alles getan, um zu verhindern, dass sie hier Wurzeln schlagen.
Eine der stärksten Wurzeln ist eine Arbeitsstelle. Von hier aus bilden sich Bekanntschaften, Freundschaften, Nachbarschaften. Irgendwann gehört man dazu. Weil wir nicht wollen, dass jemand dazugehört, solange wir nicht entschieden haben, dass er sich dazugehörig fühlen darf, sperren wir ihn lieber in einer Unterkunft ein, wo er den lieben langen Tag an die Wand starrt.
Wir sind auch erstaunlich hartherzig, wenn es darum geht, noch die absurdesten Regeln durchzusetzen, wenn wir sie durchsetzen können. Im „Spiegel“ stand neulich die Geschichte eines 14-jährigen Mädchens aus dem Jemen, das in Pinneberg eine neue Heimat gefunden hatte. Das Mädchen hatte alles richtig gemacht. Es war fleißig, wissbegierig, zielstrebig. Sie lernte schnell Deutsch. Sie wurde zur Schülervertreterin gewählt. Nach dem Abitur wollte sie Elektrotechnik studieren. Der Markt an Elektrotechnikern ist in Deutschland leer gefegt.
Dann kam sie eines Morgens nicht mehr zur Schule. Die Polizei war nachts erschienen und hatte sie und ihre Mutter mitgenommen. Da die beiden über Rumänien nach Deutschland gekommen seien, müssten sie zurück nach Rumänien, um sich dort um Asyl zu bemühen, hatte jemand in der Verwaltung nach drei Jahren befunden. „Was ist das für eine Politik? Warum drei Jahre investieren und dann wegwerfen?“, schrieb die Klassenlehrerin an die Behörde. „Das ist ein absoluter Widerspruch in allen Debatten über die Asylpolitik. All die Rufe nach Integration und Fachkräften sind nichtig, wenn wir uns diesen Fall anschauen.“
Warum es immer das Mädchen aus dem Jemen trifft und nicht den Tunichtgut aus Gambia? Es ist viel einfacher, die ordentlich integrierte Musterschülerin ins Flugzeug zu setzen als den Unruhestifter. Die Musterschülerin muss man nur an der Haustür abpassen, wenn sie vom Unterricht nach Hause kommt. Die Ausweispapiere liegen selbstverständlich griffbereit in der obersten Schublade im Flur. Sie hat auch nicht ihren Namen vergessen oder wann sie geboren wurde oder aus welchem Land sie stammt. Sie will ja hier ankommen, also hält sie sich an die Regeln. Das wird ihr dann zum Verhängnis.
Da ist der Drogenhändler aus Gambia, der im Stadtpark seinen dunklen Geschäften nachgeht, cleverer. Stammt er überhaupt aus Gambia? Das soll man ihm erst einmal nachweisen! Und wenn es gelingt, dann wird seine Botschaft schon dafür sorgen, dass er Deutschland nicht so schnell verlässt. Warum jemanden zurücknehmen, der in Deutschland doch sehr viel besser aufgehoben ist als in seiner afrikanischen Heimat?
Wir belohnen Menschen, von denen wir uns Unterstützung erwarten, fürs Nichtstun und schieben die Falschen ab. Die deutsche Ausländerpolitik ist wirklich absurd.

© Silke Werzinger