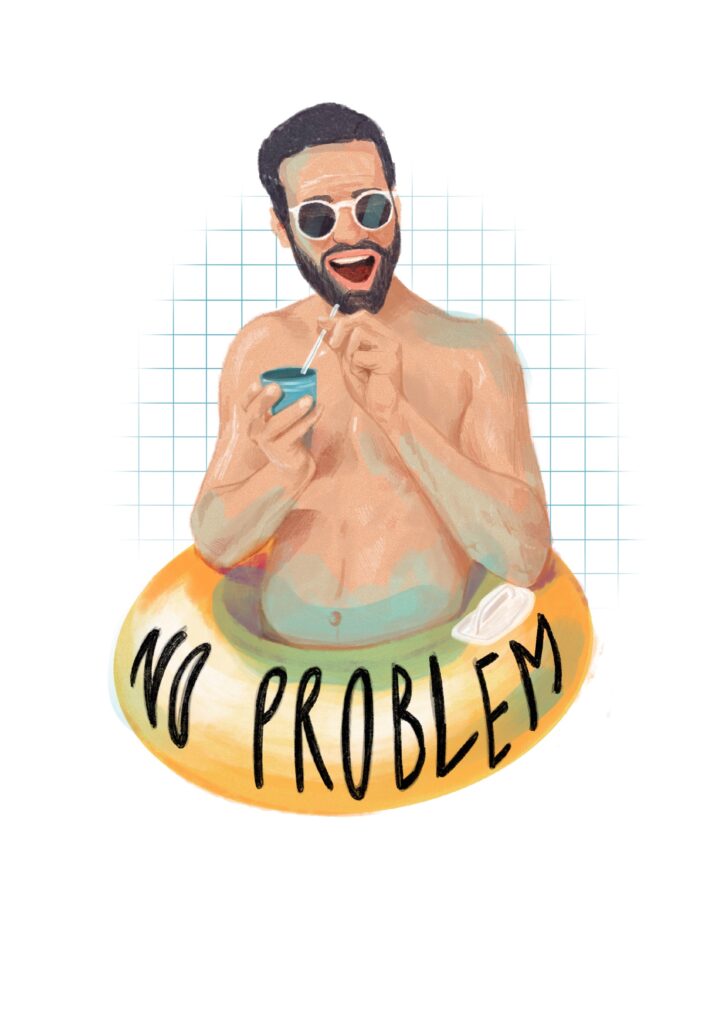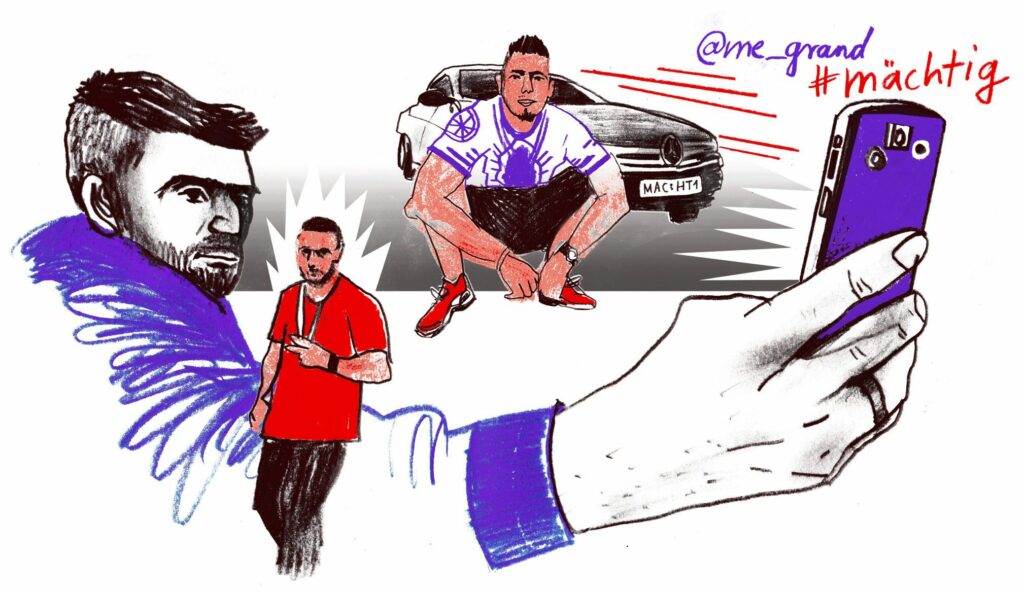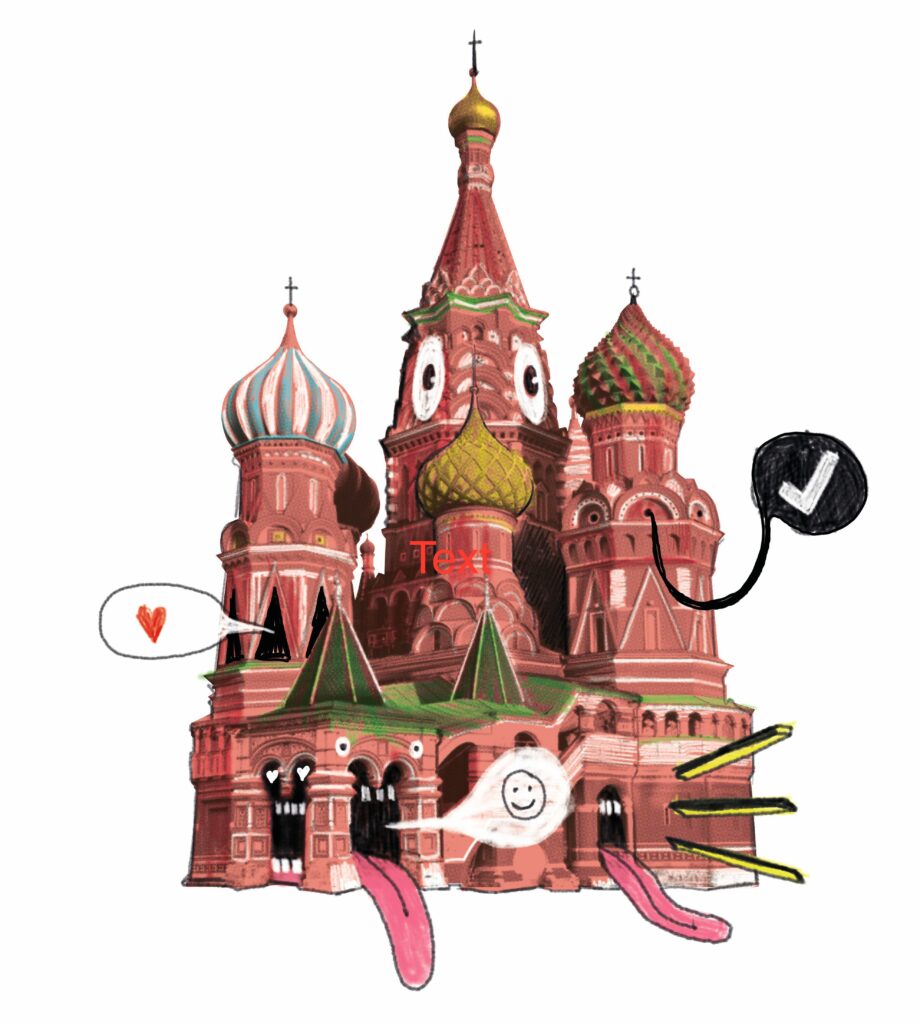Es ist ein Fehler, Mitgefühl mit Sentimentalität zu verwechseln. Leider wird beides nirgendwo so durcheinandergeworfen wie in der Sozialpolitik. Aktuelles Beispiel: Der Plan der Familienministerin zur Linderung der Kinderarmut
Ein Vorteil, wenn man von der Realität weit weg ist: Es gibt keine Veranlassung, an seiner Vorstellung von der Welt zu zweifeln.
Nehmen wir, nur als Beispiel, die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Frau Paus kommt vom linken Flügel der Grünen, wo man bis heute alle sozialen Fragen für eine Frage der Umverteilung hält. Sobald sich ein Problem auftut, nimmt man einfach die Subventionsgießkanne zur Hand und schüttet Geld drauf. Sollte sich das Problem halten, gießt man nach.
So ist auch der Plan für das größte Projekt der Ministerin, die sogenannte Kindergrundsicherung, entstanden. Um das Los armer Kinder zu erleichtern, möchte die Ministerin ein paar Milliarden in die Hand nehmen, die dann an die Eltern weitergereicht werden, die dafür all das kaufen, was sie sich bislang nicht kaufen konnten: also ganz viele Bücher und Spiele und Theaterkarten und überhaupt alles, was den Kleinen den Anschluss an die bürgerliche Welt erlaubt.
In der Welt, aus der Lisa Paus kommt, hat man vom Leben am unteren Ende der Gesellschaft eher vage Vorstellungen. Klar, man weiß, dass es arme Menschen gibt, die ihr Leben nicht richtig auf die Reihe bekommen. Schließlich ist ja in den Sozialprogrammen ständig davon die Rede, dass man die Armut in Deutschland lindern müsse.
Aber wie genau es in der Unterschicht aussieht, das entzieht sich der Anschauung. Da vertraut man auf die Vertreter der Sozialverbände wie das ehemalige Linksparteimitglied Ulrich Schneider, die einem sagen, wo man überall nachgießen muss. Wenn man als Ministerin vor die Tür tritt, dann in der Regel, um bei Parteiveranstaltungen vorbeizuschauen, wo man vornehmlich auf Leute trifft, die derselben Welt entstammen wie man selbst.
Politisch gesehen ist Kinderarmut ein Superthema. Das ist wie mit dem Einsatz für Wale und Delfine. Niemand klaren Verstandes will in den Verdacht geraten, kein Herz für Kinder zu haben. Haben Sie gesehen, was dem armen Christian Lindner passiert ist? Einmal darauf hingewiesen, dass vor allem Kinder aus Einwandererfamilie betroffen sind, und schon sind sie hinter einem her wie hinter der armen Seele. „Bösartig“, „abgrundtief ekelhaft“, „perfide“ – und das sind nur die Kommentare der Konkurrenz.
Die Fakten sind eindeutig: Die Zahl der deutschen Kinder, die auf Hartz IV angewiesen sind, ist seit 2015 um ein Drittel gesunken, ganz ohne die Anstrengungen der Grünen. Es gibt wenige gute Nachrichten aus dem Sozialstaat, das ist eine. Dass die Zahl der Leistungsempfänger dennoch bei zwei Millionen verharrt, liegt daran, dass immer mehr ausländische Kinder mit ihren Familien nachrücken.
Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass es keinen Unterschied macht, welchen Pass ein Kind hat. Das scheint auch die Meinung der Ministerin zu sein, die davon spricht, dass man die Sozialleistungen von einer Holschuld in eine Bringschuld des Staates umwandeln müsse. Ich glaube allerdings, dass in diesem Punkt selbst treue Wähler der Grünen anderer Meinung sein dürften.
Wie genau der Plan zur Behebung der Kinderarmut funktionieren soll, ist eben so vage wie die Höhe der Mittel, die Lisa Paus für erforderlich hält. Erst war von 12 Milliarden die Rede, dann von fünf Milliarden. Im „Spiegel“ sprach die Ministerin neulich von „zwei bis sieben Milliarden“ als „neuer Hausnummer“, was sich nicht einmal die Deutsche Bahn bei ihren Kostenschätzungen trauen würde. Dennoch wird unverdrossen am Projekt festgehalten.
So ist das bei den Grünen. Man lässt sich seine Gesellschaftssicht nicht von der Wirklichkeit kaputtmachen. Probleme, die man nicht sehen will, werden ignoriert. Oder wegerklärt. Oder, wenn das nicht mehr geht, Populismus genannt. Ein wunderbares Symbol für diese Form der Realitätsbearbeitung ist der Görlitzer Park in Berlin. Bevor er seine Umwidmung zum größten Open-Air-Drogenumschlagplatz Europas erlebte, war der „Görli“ das Naherholungsgebiet für die Leute, die sich ein Wochenendhaus in der Schorfheide nicht leisten können.
Dann kamen die Dealer und teilten den Park in Zonen auf: Hier die Männer aus Guinea, bei denen man sein Gras beziehen kann, auf Nachfrage aber auch Heroin, Kokain oder Crack, dort die Gambier, daneben die Leute aus dem Senegal. In München hätten sie irgendwann einen Trupp berittener Polizei geschickt, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Aber so etwas verbietet sich in einem Viertel wie Kreuzberg von selbst. Kreuzberg ist das für die Grünen, was Kulmbach für die CSU ist: Herzkammer und Quellgebiet zugleich.
Statt auf Razzien setzte die grüne Bezirksbürgermeisterin auf Sozialpartnerschaft. An Stelle von Polizisten machten sogenannte Parkläufer die Runde, die den Drogenhändlern Lehrstellen und Sprachkurse anboten, um sie in die Legalität zu geleiten. Man kann sich das Gelächter des Dealers vorstellen, als ihm der Parkläufer einen Ausbildungsplatz in Aussicht stellte, wenn er sein schändliches Tun aufgebe.
„Keine Gruppe im Park sollte ausschließlich als Problemverursacher gesehen werden“, hieß es in einem Handlungskonzept des Bezirks. „Menschen, die derzeit den Park nutzen, sollen nicht verdrängt werden.“ Weil man die Drogendealer nicht loswird, erklärt man sie einfach zur schützenswerten Minderheit: So geht grüne Sozialpolitik.
Ende Juni fielen mehrere Männer über eine junge Frau her, die so unvorsichtig gewesen war, die Erklärungen vom Park für alle ernst zu nehmen. Eine Gruppenvergewaltigung am frühen Morgen: Damit ist die Realität auch im grünen Vorzeigebezirk angekommen – sollte man meinen.
Berlins neue Innensenatorin würde den Görlitzer Park gerne mit einer Umzäunung und Videoüberwachung an den Eingängen sicherer machen. Aber das lehnt das zuständige Bezirksamt als „populistisch“ ab. Nötig sei statt eines Zauns, Sie ahnen es, mehr Geld für Sozialarbeiter!
Ich hätte einen Vorschlag, wie man gegen Kinderarmut effektiv vorgehen könnte. Wir koppeln den Bezug von Bürgergeld an den Kitabesuch. Wer vom Staat Geld haben will, muss im Gegenzug einwilligen, dass seine Kinder ab dem ersten Lebensjahr eine staatliche Einrichtung besuchen. Keine Kita, keine Sozialhilfe.
Ist das stigmatisierend? Natürlich ist es das. Aber wer sich darauf verlässt, dass andere für einen geradestehen, muss auch akzeptieren, dass man ihm Vorschriften macht, die für Leute, die selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen, nicht gelten.
Die Studienlage ist eindeutig: Wer in einer Hartz-IV-Familie aufwächst, hat ein deutlich erhöhtes Risiko arm zu bleiben. Kinder aus der Unterschicht ernähren sich öfter falsch, sie hängen zu viel vorm Fernsehen und bewegen sich zu wenig. Sie haben größere Mühe, sich zu konzentrieren und Lerninhalte zu erfassen, und neigen später eher zum Alkohol- und Drogenmissbrauch. Je früher man diesem Milieu entkommt, und sei es nur für ein paar Stunden an Tag, desto besser.
Gibt es Hartz-IV-Eltern, die sich rührend um ihre Kinder kümmern? Natürlich gibt es die. So wie es auch Eltern geben wird, die sofort losziehen und mit dem Geld von Frau Paus Schulhefte und Buntstifte für die Kleinen kaufen. Dummerweise werden aber auch der Nichtsnutz von Vater und die labile Mutter zu den Erziehungsberechtigten gehören, die über die Verwendung der Kindergrundsicherung bestimmen. Man kann es abgrundtief ekelhaft finden, darauf hinzuweisen, aber so ist die Realität.
Es ist ein Fehler, Mitgefühl mit Sentimentalität zu verwechseln. Leider wird beides nirgendwo so beständig durcheinandergeworfen wie in der Sozialpolitik.

© Sören Kunz